Mit Gaming-Narrativen die Identität junger Menschen wiederaufbauen
Angesichts der wachsenden Besorgnis über die Auswirkungen exzessiven Spielens auf das Wohlbefinden junger Menschen steigt das Interesse daran, nicht nur zu verstehen, was Spiele potenziell schädlich macht, sondern auch, was sie so fesselnd macht. Ein Aspekt, der in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder auftaucht, ist die narrative Struktur von Spielen – ein Merkmal, das insbesondere in Zeiten emotionaler oder sozialer Unsicherheit einen bedeutenden Wert für die Identitätsentwicklung und die persönliche Reflexion von Jugendlichen haben kann.
Digitale Spiele, insbesondere solche aus den Genres Rollenspiel, Abenteuer und Simulation, lassen die Spieler:innen oft in reichhaltig entwickelte Welten eintauchen, in denen sie Identitäten annehmen, Entscheidungen treffen, Ziele verfolgen und auf Herausforderungen reagieren können. Laut James Paul Gee (2003) ermöglicht diese „projektive Identität” den Spieler:innen, eine Verbindung zwischen dem, was sie sind, und dem, was sie sein möchten, herzustellen. Auf diese Weise wird Gaming mehr als nur Unterhaltung – es kann als halbstrukturierter Übungsraum für die Identitätsbildung in der realen Welt fungieren. Junge Spieler:innen experimentieren mit Rollen und Verantwortlichkeiten, setzen sich mit ethischen Dilemmata auseinander und entwickeln Erzählungen rund um die Reise ihres Avatars, die wiederum Einfluss darauf haben können, wie sie ihr eigenes Leben verstehen.
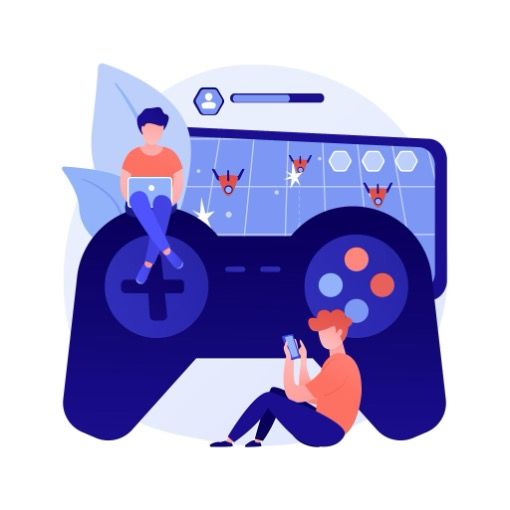
Diese Sichtweise steht im Einklang mit Theorien aus der pädagogischen und therapeutischen Praxis. Die von White und Epston (1990) entwickelte narrative Therapie betont die Fähigkeit des Individuums, die eigene Lebensgeschichte „neu zu schreiben”, indem es die vorherrschenden Narrative, die es über sich selbst erzählt, verändert. In der Jugendarbeit wurde dieser Ansatz angewendet, um jungen Menschen dabei zu helfen, von problembelasteten Geschichten („Ich bin faul“, „Ich versage immer“) zu stärkeren Geschichten („Ich bin beharrlich“, „Ich habe eine Herausforderung gemeistert“) zu gelangen. Auf den Gaming-Kontext übertragen, legt dieses Rahmenkonzept nahe, dass die Geschichten, in die junge Menschen durch Spiele eintauchen – mit ihren Handlungsbögen, Risiken und Veränderungen –, als symbolische Modelle dienen können, um ihre eigenen Selbstdarstellungen zu überdenken und neu zu gestalten.
Kurt Squire (2008) argumentiert ähnlich, dass Spiele sinnvolle Lernumgebungen schaffen, indem sie Wissen nicht nur vermitteln, sondern in einen Kontext und eine Geschichte einbetten. Auf diese Weise regen sie die Spieler:innen dazu an, über Ursache und Wirkung nachzudenken, aus Ereignissen Bedeutungen zu konstruieren und sich alternative Zukunftsszenarien vorzustellen. Dies kann besonders relevant sein für Jugendliche, die mit persönlichen Krisen, Gefühlen der Entfremdung oder Identitätsverwirrung zu kämpfen haben – häufige Vorläufer problematischen Spielverhaltens. Anstatt Spiele pauschal abzulehnen, plädieren einige Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen dafür, zu verstehen, wie diese interaktiven Geschichten als Brücken zurück zum Selbst dienen können.
Natürlich negiert dies nicht die realen und wachsenden Risiken, die mit zwanghaftem oder krankhaftem Gaming verbunden sind. Gaming-Störung wird von der Weltgesundheitsorganisation in der ICD-11 definiert als beeinträchtigte Kontrolle über das Gaming, Vorrang des Gamings gegenüber anderen Interessen und Fortsetzung des Gaming-Verhaltens trotz negativer Folgen (WHO, 2019). Unbehandelt kann dies zu Schlafstörungen, Bildungsproblemen, Beziehungsstörungen und psychischen Problemen führen. Die Risiken zu erkennen bedeutet jedoch nicht, die Chancen zu ignorieren. Durch ein besseres Verständnis dessen, was junge Menschen in Spielwelten zieht – insbesondere ihre narrative Bindung –, sind wir auch besser in der Lage, sie auf ihrem Weg zurück zu unterstützen.
Das im Rahmen des Erasmus+-Programms finanzierte Projekt MINDSET leistet einen Beitrag zu dieser sich entwickelnden Diskussion, indem es Jugendbetreuer:innen und -organisationen mit den notwendigen Ressourcen ausstattet, um Spielsucht bei Jugendlichen zu erkennen und darauf zu reagieren. Der Schwerpunkt liegt zwar auf Prävention und Früherkennung, doch erkennt das Projekt auch die Bedeutung eines umfassenderen Verständnisses der Spielkultur an, einschließlich der Art und Weise, wie junge Menschen Sinn aus Spielen ziehen.
Letztendlich ermöglicht uns das Verständnis von Spielen als narrative Räume, differenziertere Fragen zu stellen – nicht nur „Wie lange spielen junge Menschen?“, sondern auch „Welche Geschichten sprechen sie an?“ und „Welche Rollen proben sie?“ Wenn wir genau hinhören, können uns diese Geschichten dabei helfen, eine Verbindung zu den jungen Menschen hinter den Bildschirmen aufzubauen und sie dabei zu unterstützen, ihre eigene Geschichte neu zu schreiben.
Referenzen
Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan.
Squire, K. (2008). Video games and education: Designing learning systems for an interactive age. Educational Technology, 48(2), 17–26.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton.
World Health Organization. (2019). Gaming disorder. Retrieved from https://www.who.int/news/item/14-09-2018-inclusion-of-gaming-disorder-in-icd-11